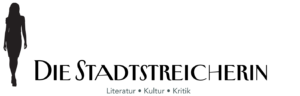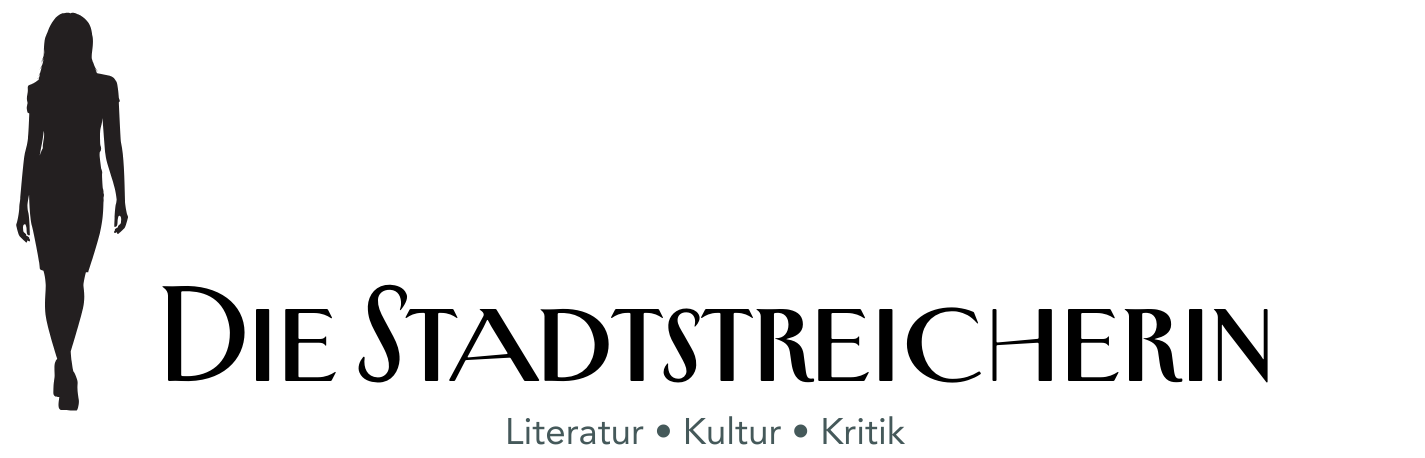[et_pb_section fb_built=“1” _builder_version=“4.27.4” _module_preset=“default” background_color=“RGBA(255,255,255,0)” custom_margin=”||||false|false” custom_padding=“0px||0px||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=“4.27.4” _module_preset=“default” width=“100%” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=“4_4” _builder_version=“4.27.4” _module_preset=“default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=“4.27.4” _module_preset=“default” background_enable_color=“off” global_colors_info=”{}”]
Lázár — Nélio Biedermann
Ein Jahrhundertroman über Schuld, Erinnerung und die leisen Folgen des Krieges
Sie zeigt, wie jede Generation einerseits für sich wirkt und zugleich auch ein Abbild ihrer Zeit ist – und in weiteren Ebenen auch in den Kindern, den unausgesprochenen Sätzen, den nie aufgedeckten Familiengeheimnissen und den Traumata, die innerfamiliäre Ereignisse und Kriege als Narben hinterlassen, fortwirkt. Sie zeigt das Ineinander-Verschränkt-Sein des Lebens mit seiner Zeit.
Der erst 22 Jahre alte Autor, der hier die längst zurückliegende Geschichte seiner heute in der Schweiz lebenden Familie erzählt, liefert einen Roman, der in seiner Erzählkunst, seiner Figurenzeichnung, seiner Tiefe und der Vielfalt der Themen mit großen internationalen Romanen mithalten kann.
Es ist die Geschichte eines alten ungarischen Adelsgeschlechts, das über Generationen hinweg von inneren wie äußeren Krisen geschüttelt wird. Ihre Geschichte ist ein Gewebe aus Schuld, Verlust und Überleben – ein Panorama des europäischen 20. Jahrhunderts, das sich von den Vorkriegsjahren über Enteignung und Flucht bis in die Gegenwart zieht.
Im Zentrum steht Lajos von Lázár, ein Kind mit durchscheinender Haut und leuchtenden blauen Augen, das von Geburt an anders, fast wie eine Erscheinung ist. Seine Zerbrechlichkeit wird zum Symbol – für das Sichtbare und das Unsichtbare. Um ihn herum entfaltet sich ein vielstimmiges Tableau aus Figuren, die einander lieben, verraten, verlieren – und doch unentrinnbar miteinander verbunden bleiben.
Biedermann schreibt in einer Sprache, die zugleich sinnlich und präzise ist. Er enthüllt die Tragödien dieser Familie nicht in großen Gesten, sondern in feinen Verschiebungen, Blicken, Schweigen. Seine Sätze tragen die Last der Geschichte, ohne sie auszustellen – vielleicht wie ein Fotoalbum, in dem die Gesichter mit der Zeit verblassen, die Erinnerungen aber schärfer werden.
Besonders hart trifft uns die Erkenntnis, wie beiläufig der Krieg in diese Welt tritt. Er kommt nicht mit Trompeten und Parolen, sondern schleicht sich ein – durch Gerüchte, Befehle, das Verschwinden von Menschen. Der Krieg trifft auch jene, die glauben, nichts mit ihm zu tun zu haben. So auch Lajos von Lázár, der entsprechend seines gesellschaftlichen Ranges während des Krieges als Offizier Dienst tut. Besonders eindringlich die Szene, in der er einen Zug Menschen durch den Ort beobachtet, für den er zuständig ist, fast wie ein Unbeteiligter, nur Ahnender:
„Es sah aus, als ginge ein Trauerzug durch die Stadt. Die Gesichter waren ernst und ängstlich, manche weinten auch, aber verhalten, so als wollten sie die Aufmerksamkeit, die ja dem Toten galt, nicht auf sich lenken. … Als habe der Regen alle Geräusche aus der Welt gespült … Dabei waren es viele, an die dreitausendfünfhundert Menschen, um genau zu sein. Obwohl Anfang Juli, trugen sie Mäntel aus dicker Wolle oder Pelz, was ein komisches Bild ergab, da die Schaulustigen, die in kleinen Trauben auf dem Bürgersteig standen, sommerlich gekleidet waren. … Auch wirkte es, als gäbe es zwischen den Trauernden und jenen am Straßenrand eine unsichtbare Grenze, als sei der Randstein eine unüberwindbare Schranke, die nicht nur von den Schaulustigen beachtet wurde, sondern auch von den Trauernden, die kaum ihren Blick hoben. Was brachte es auch, jetzt noch die Linden am Straßenrand, die Schaufenster der Geschäfte, den alten Hauseingang, an dessen Klingelschild der Name ausgetauscht war, oder die Gesichter der ehemaligen Arbeitskollegen, Nachbarn und Freunde zu sehen?“
Die bittere Erkenntnis, dass es sich um einen Zug jüdischer Mitmenschen auf ihrem Weg in den Tod handelt – wie es in so vielen europäischen Städten und Orten zur Tagesordnung gehörte – wird uns nicht auf dem Silbertablett serviert. Wir müssen es aushalten, aus der Perspektive der Gaffer am Straßenrand auf diesen „Trauerzug“ nach Auschwitz zu schauen, uns nicht abzuwenden und zu erkennen, wie beiläufig und zugleich augenfällig sich dieser Zivilisationsbruch vor aller Augen ereignet hat.
Die Privilegierung der Familie von Lázár endet im Laufe des Krieges – und vor allem danach. Sie verliert alles: Haus, Heimat, Sicherheit, selbstverständlich geglaubten Stand – und ihre Flucht dauert an, lange nach dem Ende der Kämpfe.
„Die Enteignung war so schnell vonstattengegangen, dass Pista Monate brauchte, um zu begreifen, was geschehen war. Eine Stunde, mehr benötigte der neue Staat nicht, um den Menschen alles zu nehmen.“
Erst in den 1950er Jahren finden die Nachkommen Zuflucht in der Schweiz.
Hier liegt eine weitere, stille Größe dieses Romans: Er zeigt, dass Gewalt und Vertreibung nicht an den Fronten enden. Dass die eigentliche Verwundung dort beginnt, wo man dachte, geschützt zu sein. Und dass die Flucht – körperlich, seelisch, über Generationen hinweg – nie ganz aufhört und dass sie am Ende alle trifft.
Zwischen den Zeilen dieses Romans liegt die vielleicht eindringlichste Botschaft:
Dass der Krieg nie dort bleibt, wo er begonnen hat. Er dringt ein, unbemerkt zunächst, in das Leben derer, die nichts von ihm wissen wollen oder glauben, sie müssten sich damit nicht beschäftigen – in ihre Häuser, ihre Sprache, ihre Körper. Und selbst wenn er längst vorüber scheint, setzt sich seine Bewegung fort – in Erinnerungen, in Familien, in Generationen.
Lázár erinnert uns daran, wie nah das Unheil der Geschichte immer ist, gerade wenn wir glauben, es ginge uns nichts an. Es ist eine Warnung, die nicht laut werden muss, um gehört zu werden.
Lázár ist für mich eine Entdeckung. Wenn Nélio Biedermann auch künftig dieses Weltniveau halten kann, haben wir einen neuen Star am Literaturhimmel.
Auf einen Blick
| Titel | Lázár — Nélio Biedermann |
| Format | Generationenroman, 416 Seiten |
| Empfohlen für | Leser:innen, die Familiengeschichten, historische Tiefe und poetische Sprache schätzen |
| Lesestimmung | ernst, nachdenklich, still bewegend |
| Lesetempo | eher langsam, mit Pausen zum Nachspüren |
| Kontext | Roman eines jungen Autors, der die Geschichte seiner Familie literarisch verarbeitet |
| Mein Eindruck | Ein erstaunlich reifes Werk über Erinnerung, Schuld und das Weiterwirken von Geschichte in uns allen |
Fazit
„Lázár“ ist ein stiller, großer Roman, der unter die Haut geht.
Nélio Biedermann gelingt das Kunststück, die Geschichte eines Jahrhunderts in die einer Familie zu fassen – mit einer Sprache, die mehr andeutet als erklärt, und Bildern, die lange nachhallen.
Er zeigt, wie nah die Vergangenheit uns bleibt – und dass der Krieg nie wirklich zu Ende ist, solange seine Spuren in Körpern, Beziehungen und Erinnerungen fortbestehen.
Ein Buch, das man nicht einfach liest, sondern das einen liest – Schicht für Schicht.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=“2_3,1_3” _builder_version=“4.27.4” _module_preset=“default” background_enable_color=“off” width=“100%” custom_padding=“18px|0px||0px|false|false” border_color_all=“gcid-primary-color” global_colors_info=”{%22gcid-primary-color%22:%91%22border_color_all%22%93,%22gcid-heading-color%22:%91%22background_color%22%93}”][et_pb_column type=“2_3” _builder_version=“4.27.4” _module_preset=“default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=“4.27.4” _module_preset=“default” text_font_size=“16px” global_colors_info=”{}”]
| Titel | Lázár |
| Author | Nelio Biedermann |
| Erschienen | 2025 |
| Verlag | rowohlt Verlag |
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=“1_3” _builder_version=“4.27.4” _module_preset=“default” global_colors_info=”{}”][et_pb_image src=“https://diestadtstreicherin.de/wp-content/uploads/2025/10/lazar-nelio-biedermann.jpeg” title_text=“lazar-nelio-biedermann” align=“right” _builder_version=“4.27.4” _module_preset=“default” height=“250px” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]